Dass der Mitarbeiter in der Pizzeria an der Strandpromenade so gut Englisch sprach, verwundert mich bis heute. Dabei hatte ich in den letzten Tagen nach den ungeahnten Ereignissen und Begegnungen mein Italienisch deutlich aufgebessert. Follonica war keine Stadt, in die man fuhr, weil man sie sehen wollte. Man fuhr hin, weil man etwas brauchte. Bargeld. Einen gut sortierten Supermarkt. Vielleicht ein Ladegerät. Die Stadt lag flach, wie ausgebreitet am Meer. Keine Höhe, kein Widerstand.
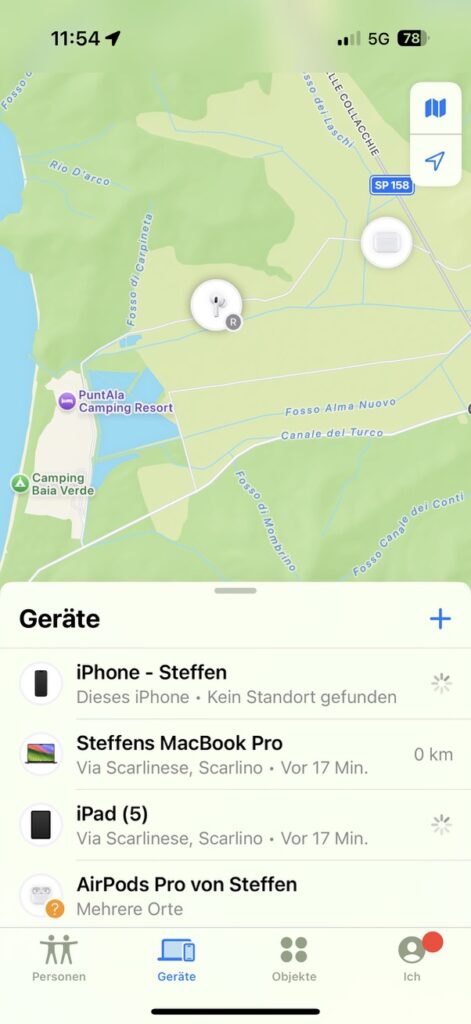

Dieser Mann – ein junger Mann mit schwarzen Locken, der hier in den Sommerferien arbeitete – bestand darauf, mit mir Englisch zu sprechen. Er nannte seinen Namen und wiederholte meinen Namen mehrfach. Freundlich und engagiert nahm er meine Bestellung auf. Nur Straßen, Ampeln, Kreisverkehre, eine Tankstelle mit überlaufen Mülleimern, ein paar uninteressante Boutiquen, ein geschlossenes Tabacchi. Und das Meer – irgendwo hinter den Gebäuden. Vielleicht war Follonica nur der Versuch einer Stadt.
Die Pizza war lecker, aber etwas lieblos belegt. Auch der Aperol Spritz war fad. Dennoch erwiderte ich beim Abräumen der Teller auf seine Frage, ob es mir geschmeckt habe, dass es sehr, sehr lecker war. Ich zahlte mit Karte, gab ein wenig Trinkgeld und ging zurück auf die Promenade, um ein bisschen zu schlendern und einen guten später ein Taxi zu suchen.


Das Licht in diesen Wäldern war nicht dramatisch. Es fiel matt durch das Geäst, wie durch einen Schleier aus kratziger Wolle. Kein italienisches Sonnenlicht im klassischen Sinn, nichts Cinematografisches – sondern ein gedämpftes, fast müdes Leuchten, wie von gewalktem Flanell, grau-grün, staubig, schweigend.
Früher glaubte ich, Banditen lebten in Höhlen. Mit Feuerstellen und Fellen und schmutzigen Fingern. „Bandite di Scarlino“ – als hätte man sich an das Bedrohliche gewöhnt. Als sei es romantischer, wenn der Wald von Räubern erzählt.